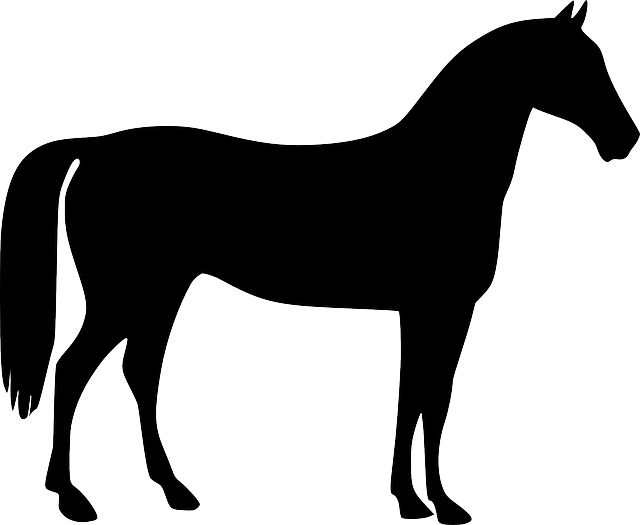Hufrehe ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die Pferde stark beeinträchtigen und ihre Lebensqualität einschränken kann. Ursache ist oft eine Fehlregulation im Stoffwechsel sowie eine zu hohe Aufnahme von Energie und Kohlenhydraten, wodurch die Hufstruktur geschädigt wird. Dabei treten meist klare Symptome wie Lahmheit und sichtbare Schwellungen auf, die frühzeitig erkannt werden sollten. Unbehandelt können die Folgen dauerhaft sein und die Mobilität des Tieres erheblich beeinträchtigen. Deshalb ist es entscheidend, bei ersten Anzeichen umgehend einen Facharzt zu konsultieren, um den Verlauf in kontrollierbare Bahnen zu lenken.
Übermäßige Energie- und Kohlenhydrataufnahme
Eine häufige Ursache für Hufrehe ist die übermäßige Energie- und Kohlenhydrataufnahme bei Pferden. Besonders bei Fütterung mit reichlich Getreide, Silage oder zu viel Heu kann es zu einer Überladung des Verdauungstrakts kommen. Dabei wandeln die Darmbakterien die aufgenommenen Stärke und Zucker in Säuren um, was den pH-Wert im Darm beeinflusst und das Gleichgewicht stört. Dieser Prozess führt dazu, dass kurzfristig vermehrt Nährstoffe ins Blut gelangen und der Stoffwechsel ins Ungleichgewicht gerät.
Ein Überschuss an Energie bringt den Stoffwechsel durcheinander, was wiederum die Funktion der Hormone beeinflussen kann. Insbesondere bei Pferden mit einem empfindlichen Stoffwechsel steigt somit das Risiko, eine Hufrehe zu entwickeln. Daher gilt es, die Futtermittel so auszuwählen, dass die Energieaufnahme kontrolliert bleibt. Eine ausgewogene Fütterung vermeidet nicht nur Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, sondern schützt auch die Hufe vor irreversiblen Schäden durch eine Entzündung.
Es ist ratsam, auf die Qualität und Quantität der Futtergaben zu achten. Übermäßiges Füttern von Kraftfutter oder energiehaltigem Getreide sollte vermieden werden, besonders bei bereits problematischen Tieren. Stattdessen empfiehlt sich eine ballaststoffreiche Ernährung, die die Verdauung unterstützt und die Gefahr einer Überladung minimiert. Dadurch kannst du aktiv dazu beitragen, die Gesundheit deiner Pferde langfristig zu sichern und einen Ausbruch von Hufrehe zu verhindern.
Auch interessant: Fraktur beim Pferd – wann eine Operation unumgänglich ist
Hormonelle Einflüsse und Stoffwechselstörungen

Hormonelle Einflüsse und Stoffwechselstörungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Hufrehe. Bei Pferden, die an einem gestörten Hormonhaushalt leiden, kann sich die Gefahr einer Erkrankung deutlich erhöhen. Besonders bei Stuten in der Trächtigkeit oder während des «Eisprungs» schwellen die hormonellen Schwankungen an und beeinflussen das Stoffwechselgeschehen im Körper negativ.
Ein häufig auftretendes Problem ist die sogenannte Insulinresistenz. Dabei reagiert der Organismus nicht mehr ausreichend auf Insulin, wodurch die Glukoseaufnahme in die Zellen erschwert wird. Dies führt zu erhöhten Blutzuckerwerten, die wiederum das Risiko für entzündliche Prozesse in den Hufen steigern. Die chronische Überladung mit Zucker und die daraus resultierenden Entzündungen können schädigende Veränderungen an den Hornkapseln hervorrufen, was schließlich die Entwicklung einer Hufrehe begünstigt.
Stoffwechselstörungen wie Cushing-Syndrom oder Hashimoto-ähnliche Zustände sind ebenfalls bekannte Auslöser. Sie beeinträchtigen die Funktion verschiedener Drüsen und beeinflussen so die Regulation der Hormone. Dieses Ungleichgewicht wirkt sich direkt auf die Durchblutung der Hufe aus und fördert die Ablagerung krankhafter Stoffe in den Hufstrukturen. Daher ist es besonders wichtig, solche Störungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
Plötzliche Bewegungsmangel oder Dauerruhe
Plötzlicher Bewegungsmangel oder eine längere Dauerruhe können bei Pferden schwerwiegende Folgen haben, insbesondere wenn sie bereits Anzeichen einer beginnenden Hufrehe zeigen. Während normale Ruhephasen wichtig sind, kann eine unvermittelte oder zu lange Dauer der Ruhephase den Stoffwechsel negativ beeinflussen. Wenn ein Pferd beispielsweise nach einer Verletzung oder Operation inaktiv gehalten wird, verändert sich die Durchblutung im Hufbereich. Die schlechtere Durchblutung führt dazu, dass Nährstoffe und Sauerstoff weniger effektiv an die Hufstrukturen gelangen.
Diese Veränderung kann Reaktionen im Gewebe auslösen, die das Risiko für Entzündungen oder weitere Schäden erhöhen. Besonders während solcher Ruhezeiten ist es wichtig, die Bewegungsfreiheit so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, um Kreislauf und Stoffwechsel stabil zu halten. Wird die Bewegung allerdings drastisch eingeschränkt oder völlig eingestellt, steigen die Chancen für dadurch bedingte Veränderungen am Huf weiter an.
Auch bei Erkrankungen oder akuten Problemlagen sollte die Entscheidung für vollständige Ausschluss der Bewegung gut durchdacht sein. Das Ziel muss immer sein, die Muskulatur anzuspitzen, die Durchblutung zu fördern und so dem Fortschreiten einer möglichen Rehe vorzubeugen. Es ist ratsam, die Dauer der Ruhe mit einem Tierarzt abzusprechen und gezielt Übungen einzubauen, um den Stoffwechsel möglichst aktiv zu halten – auch in Phasen der Behandlung oder Genesung.
Symptome: Lahmheit und geschwollene Hufe
Ein deutlich erkennbares Symptom bei Hufrehe ist die Lahmheit. Das betroffene Pferd zeigt häufig ein unsicheres Gangbild, trippelt oder schont den betroffenen Huf. Bereits kleinste Bewegungen können Schmerzen auslösen, was sich darin widerspiegelt, dass das Tier beim Gehen den Fuß leicht anhebt oder nur auf drei Beinen tritt. Die Lahmheit äußert sich meist schmerzhaft und kann je nach Schweregrad unterschiedlich ausgeprägt sein.
Auch die Schwellung der Hufe ist typisch für diese Erkrankung. Dabei schwellen die Hornkapseln sichtbar an, insbesondere im Bereich des Kronrandes. Diese Schwellungen sind oft warm und druckempfindlich, was die Entzündung weiter unterstreicht. Manchmal lässt sich eine übermäßige Druckempfindlichkeit feststellen, wenn du den Huf abtastest. Das Tier reagiert heftig, wenn Druck ausgeübt wird, was auf die akute Entzündungsreaktion hinweist. In einigen Fällen kannst du auch Veränderungen an der Hufwand sehen, beispielsweise Risse oder Verformungen, die durch die Flüssigkeitseinlagerung entstehen.
Das Zusammenwirken dieser Symptome – Lahmheit und geschwollene Hufe – deutet auf eine akute Rehediagnose hin und sollte unverzüglich vom Tierarzt geprüft werden. Frühzeitig erkannt und behandelt, lassen sich dauerhafte Schäden oftmals verhindern oder zumindest minimieren. Es ist wichtig, auf eine intensive Betreuung zu achten, damit dein Pferd rasch wieder belastbar wird und die Beschwerden deutlich abnehmen.
Siehe auch: Spanische Pferde in Not
| Ursache | Symptome | Langzeitfolgen |
|---|---|---|
| Übermäßige Energie- und Kohlenhydrataufnahme | Lahmheit, geschwollene Hufe, Überladung des Verdauungstrakts | Hufablagerungen, Kreislaufprobleme |
| Hormonelle Einflüsse und Stoffwechselstörungen | Hormonelle Schwankungen, Insulinresistenz, Durchblutungsstörungen | Dauerhafte Schäden an den Hufstrukturen, Entzündungen |
| Plötzliche Bewegungsmangel oder Dauerruhe | Schlechtere Durchblutung, Bewegungsunruhe, Gehleistung | Entzündungen, Gewebeveränderungen, Verschlechterung des Zustands |
Unbehandelte Hufrehe kann dauerhafte Schäden verursachen

Wenn Hufrehe unbehandelt bleibt, können die Folgen für das Pferd schwerwiegend sein. Dauerhafte Schäden an den Hufstrukturen sind häufig die Folge, was dazu führt, dass sich die Beweglichkeit und Lebensqualität des Tieres deutlich verschlechtern. Entzündungsprozesse, die durch eine unzureichende Behandlung entstehen, greifen tiefer in die Hornkapseln und Knochen ein. Dadurch kann es zu Verformungen kommen, die nur schwer wieder rückgängig gemacht werden können.
In einigen Fällen kommt es zu Veränderungen im Knochenaufbau und zur Ablagerung von krankhaften Substanzen im Hufbereich. Diese Veränderungen beeinträchtigen die Stabilität des Hufes langfristig und führen oftmals zu chronischer Lahmheit. Besonders gefährlich ist, dass diese Schäden nicht immer sofort sichtbar sind, sondern sich erst im Verlauf der Erkrankung verstärken. Aus diesem Grund ist eine frühe Diagnose und entsprechende Behandlung enorm wichtig, um dauerhafte Beeinträchtigungen für das Tier zu vermeiden.
Auch das Risiko für sekundäre Beschwerden steigt, wenn die Grunderkrankung nicht geklärt wird. Schlechte Durchblutung oder Gewebeverschlechterungen können die Heilung erschweren und chronische Entzündungen begünstigen. Es ist daher unerlässlich, bei ersten Anzeichen zügig tierärztlichen Rat einzuholen und gezielt gegen die Ursachen vorzugehen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Chancen auf eine vollständige Genesung steigen und bleibende Schäden vermieden werden.
Lesetipp: Auslauf für Pferde
Frühzeitige Diagnose und Behandlung entscheidend

Bei Verdacht auf Hufrehe ist eine frühzeitige Diagnose unerlässlich, um bleibende Schäden zu vermeiden. Sobald erste Anzeichen wie Lahmheit oder Unwohlsein auftreten, sollte so schnell wie möglich ein Tierarzt konsultiert werden. Eine genaue Untersuchung und die Verwendung von bildgebenden Verfahren ermöglichen es, den Zustand des Hufs zu beurteilen und eine geeignete Behandlung einzuleiten.
Je früher die Behandlung beginnt, desto größer sind die Chancen auf eine vollständige Genesung. Besonders bei milden Symptomen können rechtzeitig getroffene Maßnahmen dazu beitragen, die Entzündung zurückzudrängen und weiteren Schaden zu verhindern. Es ist wichtig, die Ursachen für die Beschwerden zu identifizieren, da diese die Grundlage für die passende Therapie bilden.
Unsachgemäße oder verzögerte Behandlungsmaßnahmen können dazu führen, dass sich die Erkrankung verschlechtert und dauerhafte Strukturschäden entstehen. Diese setzen die Mobilität des Pferdes aufs Spiel und beeinträchtigen seine Lebensqualität erheblich. Daher erhöht die zeitnahe Reaktion auf erste Symptome die Chance auf einen günstigen Verlauf und vermindert langfristige Belastungen für das Tier.
| Ursache | Symptome | Langzeitfolgen |
|---|---|---|
| Ungleichgewicht in der Fütterung, z.B. zu viel Getreide | Schmerzhaftes Langegehen, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, geschwollene Hufe | Strukturelle Schäden im Huf, chronische Lahmheit |
| Hormonelle Schwankungen, insbesondere bei Stuten | Verändertes Gangbild, erhöhte Empfindlichkeit, Hufschwellung | Ausgeprägte Veränderungen der Hufstruktur, dauerhafte Lahmheit |
| Schnelle Bewegungseinschränkung, z.B. durch Verletzung | Minimale Bewegung, Lahmheit, schnelle Verschlechterung des Zustands | Verlust der Huffunktion, bleibende Schäden |
Langzeitfolgen: Hufablagerungen und Kreislaufprobleme
Wenn die Erkrankung unbehandelt bleibt, können sich langfristig erhebliche Schäden am Hufgewebe entwickeln. Hufablagerungen sind dabei häufig sichtbare Folgen, die durch chronische Entzündungsprozesse entstehen. Diese Ablagerungen beeinflussen die Stabilität des Hufes negativ und beeinträchtigen die Hufmechanik dauerhaft. Die Folge ist oft eine anhaltende Lahmheit, die die Beweglichkeit des Pferdes stark einschränkt. Im schlimmsten Fall führt dies dazu, dass das Tier kaum noch belastbar ist und dauerhafte Beschwerden auftreten.
Ein weiterer Aspekt bei den Langzeitfolgen betrifft die Kreislauffunktionen. Durch die andauernde Entzündung verschlechtert sich die Durchblutung im Bereich der Hufe. Dies kann zu Kreislaufproblemen führen, die nicht nur die lokale Gesundheit beeinträchtigen, sondern auch allgemeine Auswirkungen auf den Teri haben. Es nimmt mehr Energie in Anspruch, die ansonsten für Heilungsprozesse oder die Aufrechterhaltung eines normalen Stoffwechsels zur Verfügung stehen würde. Somit wird die Genesung erschwert, und die Ordnung im Organismus bleibt gestört, was wiederum weitere gesundheitliche Probleme begünstigen kann.
Langfristig besteht die Gefahr, dass sich diese körperlichen Veränderungen verstärken und so den Alltag deines Pferdes erheblich beeinträchtigen. Besonders problematisch ist, dass Veränderungen oft erst spät erkennbar sind, weshalb eine frühzeitige Behandlung entscheidend ist, um bleibende Schäden zu verhindern. Regelmäßige Kontrolle sowie eine fachgerechte Versorgung spielen somit eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung der Gesundheit.